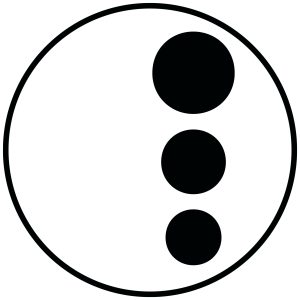Vom Zuhören und vom Lernen
Was ist davon zu halten, wenn in öffentlichen Debatten das Zuhören-Können mit zunehmender Dringlichkeit eingeklagt wird? Wenn das Zuhören überdies mit der Bereitschaft zu lernen kombiniert wird? Verweist dies tatsächlich auf eine steigende Sensibilität für Fragen der Teilhabe? Oder sind hier auch andere Motive im Spiel? Und wenn ja – welche?
Es steht viel auf dem Spiel, wenn Bewegung in das Vokabular kommt, auf das wir zurückgreifen, um uns zu verständigen. Wenn neue Begriffe in der Öffentlichkeit zirkulieren oder wenn vertraute eine andere Bedeutung annehmen, wenn sich ihr Klang zu verändern beginnt.
Der unlängst verstorbene Robert Spaemann, ein Philosoph mit feinem Gespür für die Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, wusste darum. Er beobachtete in den 1970ern den Siegeszug der Rede von Emanzipation mit Sorge und warnte davor, diese Entwicklung in ihren Folgen zu unterschätzen. In einem viel beachteten Vortrag hielt er fest: „Hinter dem Streit um Worte steckt ein Streit um Sachen. Andererseits gibt es die menschlichen Sachen nicht ohne die Worte, in denen sie sich ausdrücken. Deshalb muss man den Streit um Worte ernst nehmen.“1
Jürgen Habermas tat ihm den Gefallen und nahm den Fehdehandschuh auf. In einer Replik pflichtete er seinem Kontrahenten zunächst in einem Punkt bei: Auch er hielt die semantischen Neuerungen für hoch bedeutsam. Allerdings bewertete er sie völlig anders. Im Unterschied zu Spaemann und dessen konservativen Weggefährten schätzte Habermas die US-amerikanischen Theorieimporte. Die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse sei, so seine Überzeugung, zwingend auf Begrifflichkeiten aus den Sozialwissenschaften angewiesen. Erst mit ihrer Hilfe könne es gelingen, den Status quo als fragwürdig erscheinen zu lassen und das historisch Gewordene als veränderbar. Dass Begriffe wie Sozialisation von manchen als „Elemente der Verunsicherung“ erlebt würden, sei daher ausdrücklich zu begrüßen.2
Fast fünfzig Jahre später kommt es zu einem bemerkenswerten Déjà-vu. Erneut streiten wir um Begriffe und Theorieimporte; erneut fürchten manche, dass linke Gruppierungen in den Hörsälen die Definitionshoheit erringen und das ausüben, was der Soziologe Helmut Schelksy damals als Menetekel an die Wand gemalt hatte: „Herrschaft durch Sprache“.3 Sorgten seinerzeit die Rede von Emanzipation, Sozialisation und struktureller Gewalt für Aufregung, setzen nun Vokabeln wie Wokeness, Microagressions und Trigger Warnings die öffentlichen Debatten unter Strom. Diese Begriffe führten nicht nur zu einer heillosen Moralisierung wissenschaftlicher und politischer Diskurse, sie beförderten überdies eine Cancel Culture, die einen scharf geführten argumentativen Streit kaum noch zulasse – so ist immer wieder zu lesen.
Ungleich interessanter als die dramatisierenden Vorwürfe, die bisweilen auch von der Angst um den Verlust einer hegemonialen Sprecherposition diktiert scheinen, sind solche Beiträge, die der Veränderung von Begriffen nachspüren, die zunächst wenig spektakulär anmuten. So hat Nils Minkmar unlängst in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung die Frage aufgeworfen, wie die Konjunktur der Rede von einem „breiten gesellschaftlichen Dialog“ zu erklären sei. Gerade weil der „Gipfel des Dialogischen“ – die Diskussion „auf Augenhöhe“ – überaus verlockend klinge, erinnerte er daran, dass es ein Trugschluss wäre zu glauben, „die Machtoptionen seien so gleich verteilt wie die Möglichkeit mitzuquasseln“.4
Wer sich an einem solchen „breiten gesellschaftlichen Dialog“ beteiligen möchte, muss eine Fähigkeit mitbringen, die seit einigen Jahren mit zunehmender Dringlichkeit eingeklagt wird. Er oder sie muss zuhören können. Damit ist freilich weniger das elementare Vermögen gemeint, akustische Reize empfangen und korrekt entschlüsseln zu können. Das Zuhören-Können kennzeichnet vielmehr jene Zeitgenossen, die Interesse am Gegenüber aufbringen und ihm ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie tun dies nicht aus ordinärer Neugierde, sondern aus durchweg hehren Motiven: Sie wissen um die begrenzte Reichweite der eigenen Perspektive; sie ahnen vielleicht sogar, dass sie zahlreiche Privilegien genießen und diese ihre Sicht der Dinge prägen. Das Signal, dass man nun zuhöre, hat daher häufig etwas Bekenntnishaftes; mitunter erinnert es an ein Schuldeingeständnis.
Typisch für das Lernsubjekt ist demnach, dass seine Routinen ins Leere laufen, dass es zu einer Umorientierung genötigt wird. Der Lernprozess in diesem Sinne folgt gerade keiner Logik der Akkumulation; er bricht mit dem Weiter-so und nimmt seinen Ausgang von einer schmerzhaften Zäsur.
Problematisch ist diese Attitüde, weil sie die Illusion nährt, aus Gesellschaften könnten wieder Gemeinschaften werden. Darauf haben unlängst die beiden Schweizer Historiker*innen Svenja Goltermann und Philipp Sarasin hingewiesen. Ihnen gilt die Rede vom Zuhören als der „Polit-Kitsch unserer Tage“, der gefährliche Sehnsüchte evoziere: „Es ist der Traum davon, dass die Gesellschaft, wenn man sich nur gut zuhört, wenn jeder seine Wahrheit sagen und jeder und jede ‚anerkannt‘ würde, letztlich ‚ganz‘, ‚heil‘ und ohne Konflikte sein könnte.“5 Dass solche Fantasien von rechter Seite aufgegriffen und gezielt instrumentalisiert werden, muss nicht verwundern. Nicht allein der Pegida-Aktivist Lutz Bachmann hat in der Vergangenheit wiederholt eingeklagt, dass die Angehörigen der politischen Elite ihnen – also den Demonstrationsteilnehmer*innen – endlich „zuhören“; auch Marine Le Pen nutzte die Proteste der Gelbwesten, um dem französischen Präsidenten vorzuhalten, er höre nicht zu und kreise um sich selbst.
Die Tugend des Zuhörens hat zwar noch nichts von ihrem Glanz eingebüßt, aber sie lässt sich – so scheint es – noch steigern. Und dies geschieht, indem das passive Moment, das dem Zuhören eignet, mit einem aktiven kombiniert wird. Es reicht augenscheinlich nicht mehr, „nur“ zuzuhören. Das Vernehmen anderer Standpunkte muss in der betreffenden Person etwas auslösen, etwas in Bewegung versetzen. Und dies wird neuerdings als Lernen ausgegeben. Die romantisierende Rede vom Zuhören erhält also ein wichtiges Update: Wer heute signalisieren will, dass er oder sie nicht zur Fraktion der unbelehrbaren Ignorant*innen gehört, zu den ressentimentgeladenen Zeitgenoss*innen, bemüht jene Formel mit schöner Regelmäßigkeit – gibt also zu erkennen, künftig „zuzuhören und zu lernen“.
Beliebt ist die Formel nicht nur in der Politik, deren professionelle Vertreter*innen ohnehin den Vorwurf fürchten, eine „abgehobene“ Politik zu betreiben und den Kontakt zur Lebenswelt der „einfachen Leute“ verloren zu haben. Nicht minder populär ist sie in Kunst und Kultur. Als unlängst die Documenta 15 zu Ende ging und ein Vertreter von Ruangrupa, dem indonesischen Kurator*innenkollektiv, von Medienvertreter*innen um ein Statement zum Schluss der umstrittenen Kunstschau gebeten wurde, gab er zu Protokoll, dass sie, die verantwortlichen Kurator*innen, „zuhören“ und „lernen“ würden.
Auch wenn diese formelhafte Antwort in der Berichterstattung kaum einmal aufgegriffen wurde – wohl auch deshalb, weil sie den Ton sehr genau trifft, der in öffentlichen Debatten derzeit gepflegt wird –, ist sie für einen Vertreter der Erziehungswissenschaft doch irritierend. Lernen zählt seit jeher zu den pädagogischen Schlüsselbegriffen und weist eine weit zurückreichende Geschichte auf. Schon in der griechischen Antike wurde intensiv über das nachgedacht, was wir heute Lernen nennen. Doch so unterschiedlich die Beiträge sind, die hierzu vorgelegt wurden, keiner scheint geeignet, die beruhigende Wirkung, die von der Zusicherung ausgeht, man sei dabei, zu „lernen“, argumentativ abzusichern. Das Gegenteil ist der Fall. Anspruchsvolle Lerntheorien akzentuieren das Irritierende und Verstörende; sie betonen das Unbequeme und die Zumutung des Lernens.6
Typisch für das Lernsubjekt ist demnach, dass seine Routinen ins Leere laufen, dass es zu einer Umorientierung genötigt wird. Der Lernprozess in diesem Sinne folgt gerade keiner Logik der Akkumulation; er bricht mit dem Weiter-so und nimmt seinen Ausgang von einer schmerzhaften Zäsur. Der Erziehungswissenschaftler Dietrich Benner hat dies in die Gestalt einer Frage gekleidet: „Wie vollzieht sich Lernen im Raum zwischen der Erfahrung der Negativität und ihrer bestimmter Negation, in jenem Niemandsland also, in dem die Enttäuschung eines Vorwissens manifest, die Umstrukturierung des Wissens und seines Gegenstandes aber noch nicht gelungen, die Negativität einer Irritation erlitten, die Not, in welche diese führt, aber noch nicht gewendet, das Alte zwar als problematisch erkannt, die Lösung aber noch nicht gefunden ist?“7
Es geht an dieser Stelle nicht darum, die Teilnehmer*innen öffentlicher Debatten auf einen fachwissenschaftlichen Diskurs zu verpflichten und einen korrekten Sprachgebrauch anzumahnen. Wichtiger ist, dass auf die Rede vom „Zuhören und Lernen“ nun ein anderes Licht fällt. Lernprozesse im hier angedeuteten Sinne nehmen ihren Ausgang meist von Erfahrungen des Versagens: Weil habituelle Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten, wird das lernende Subjekt zu einer Neubestimmung gezwungen. Es sieht sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, neue Formen der Erfahrungsverarbeitung zu entwickeln.
Und eben diese Haltung lässt sich nur höchst selten bei jenen erkennen, die in Presseerklärungen, Interviews oder Zeitungsartikeln versichern, dass sie künftig „zuhören“ und „lernen“ würden. Die Erklärung kommt den Betroffenen meist ein wenig zu schnell und zu leicht über die Lippen. Sie hat dadurch etwas Eilfertiges – und weckt den Verdacht, dass hier ein Wording gefunden wurde, das es ermöglicht, die Verantwortung für ein Fehlverhalten auf elegante Weise von sich zu weisen. Statt Fehler einzuräumen und für die Folge einzustehen, wird einfach das Register gewechselt. Und eine Pädagogisierung der Kommunikation betrieben. Wo es um die Klärung von Zuständigkeiten und die Suche nach Ursachen gehen müsste, um die Identifizierung von beteiligten Akteur*innen und die Zurechnung von Verantwortung, erscheint nun ein Reich des Pädagogischen, in dem sich die Kritisierten ihrem individuellen Lernprozess widmen. Menschenfeindliche Ideologien wie der Antisemitismus schrumpfen dann unmerklich und werden zum Auslöser von Lernprozessen. Es ist ein hoher Preis, der für diese Form des „Lernens“ bezahlt wird – nicht allein von Jüdinnen und Juden.
1 Robert Spaemann, Emanzipation – ein Bildungsziel?, in: Merkur 29 (1975), S. 11-24, hier S. 12.
2 Jürgen Habermas, Umgangssprache, Wissenschaftssprache, Bildungssprache, in: Merkur 32 (1978), S. 327-342, hier S. 331 und S. 338.
3 Ebd. S. 328.
4 Nils Minkmar, Ruhe, bitte. Ständig und zu jedem Anlass wird der „breite gesellschaftliche Dialog“ gefordert. Warum wohl?, in: Süddeutsche Zeitung am 07.07.2022, S. 9.
5 Svenja Goltermann/Philipp Sarasin, #Zuhören. Die politischen Fallstricke einer schönen Idee, in: Geschichte der Gegenwart: https://geschichtedergegenwart.ch/zuhoeren-die-politischen-fallstricke-einer-schoenen-idee/, 2019, [abgerufen am 3.10.2022].
6 Vgl. hierzu: Käte Meyer-Drawe, Diskurse des Lernens, München: 2008.
7 Dietrich Benner, Einleitung. Über pädagogisch relevante und erziehungswissenschaftlich fruchtbare Aspekte der Negativität menschlicher Erfahrung, in: Ders. (Hrsg.): Erziehung – Bildung – Negativität. 49. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik, Weinheim-Basel: 2005, S. 7-23, hier S. 12.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die rauchzeichen-Kolumnen bieten Ihnen Denkanstöße in der digitalen Welt über die reale Welt, Stellungnahmen und Positionen, aber auch Abseitiges, zum Hinschauen Führendes, Botschaften, die zur Annäherung einladen. Sie hinterfragen eingefahrene Positionen in gegenwärtigen Debatten. Sie wagen Quer- und Seitenblicke und zeigen neue Verbindungen und Zusammenhänge auf. Überparteilich, nicht-akademisch, pointiert.
Um möglichst viele Leserinnen und Leser zu erreichen, werden alle Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Werbeeinnahmen wird zugunsten einer angenehmen Leseerfahrung verzichtet.
Die Autorinnen und Autoren schreiben unbezahlt, und die Herausgeber stecken viel ehrenamtliches Engagement sowie eigene finanzielle Mittel in die Plattform. Damit wir die laufenden Kosten für Webmaster und Softwarepflege decken können, sind wir auf die freiwillige Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Sie können unsere Arbeit unterstützen: mit einem Abo auf Steady (in unterschiedlicher Größe) oder mit einer direkten Zuwendung.
Sie helfen uns auch sehr, indem Sie unsere Kolumnen bei Twitter, Instagram und Facebook liken oder teilen.
Vielen Dank!