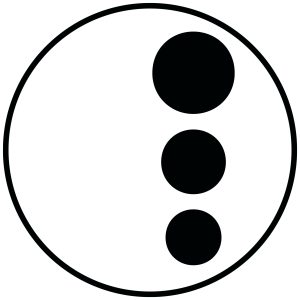Safe Spaces
Es klingt vernünftig, wenn mehr und mehr Einrichtungen „Safe Spaces“ schaffen möchten. Es sollte doch uneingeschränkt begrüßt werden, dass sich nicht nur Clubs und Festivals für „sichere Räume“ einsetzen, sondern auch Schulen und Hochschulen. Wer würde Zweifel daran anbringen, dass Betroffenen von Diskriminierung Gehör geschenkt und ihrem Befinden Rechnung getragen werden sollte?
Derzeit ist viel von „Safe Spaces“ die Rede. Die Wendung taucht in unterschiedlichsten Kontexten auf, ist in aller Munde, und auf dem Sprung, zu einer neuen Leitvokabel zu werden, so scheint es. Blickt man auf deren Anfänge zurück, muss das überraschen. Obgleich sie in den USA der 1970er Jahre schon vereinzelt von Vertreter*innen der Bürgerrechtsbewegung benutzt wurde, verdankt sie ihre begriffliche Präzisierung dem pädagogischen Diskurs. Ende der 1980er Jahre berichtete Christine Hawkins in einer didaktischen Zeitschrift von einem ihrer Schüler. In einem kurzen Artikel erläuterte die Lehrerin, wie es ihr gelungen war, dass Caleb, ein schüchterner und verängstigter Viertklässler, wieder am Unterrichtsgeschehen teilnahm. Sie hatte gehört, wie er eines Tages mit seinem Bleistift hantiert und diesen mit dem Kommentar, ihn wieder in einen „Safe Space“ zu bringen, in seinem Federmäppchen verstaut hatte. Kurz darauf brachte sie ihrem Schüler einen großen Karton mit. Sie lud ihn dazu ein, damit seine Schulbank zu einem sicherheitsspendenden Möbelstück umzubauen. Caleb nahm diese Einladung dankbar an, stattete den Karton entsprechend aus und war fortan wieder in der Lage, am Unterricht teilzunehmen. Manche Mitschüler*innen folgten seinem Beispiel und richteten sich nun ebenfalls häuslich ein.1
Indes, – es blieb nicht bei dieser Begebenheit. Die Rede vom „Safe Space“ löste sich von ihrem fachdidaktischen Kontext, innerhalb dessen sie entstanden war, und entwickelte sich zu einer Debatte, die rasch an Fahrt aufnahm. Schon bald wurden Forderungen laut, „Safe Spaces“ auch jenseits von Schulen einzurichten. Mit dem durchschlagendsten Erfolg fraglos an US-amerikanischen Eliteuniversitäten. Hier, wo sich der Nachwuchs der liberalen Upper Class tummelte und sich auf die Übernahme bestens dotierter Jobs vorbereitete, mutierte der Seminarraum bald mehr und mehr zum Klassenzimmer. Die Studierenden pochten darauf, von den Lehrenden als verletzbare Personen wahrgenommen zu werden – mithin als Lernsubjekte, die vielerlei Zumutungen zu gewärtigen hätten. Und sie verlangten von den Hochschulleitungen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Als höchst folgenreich sollte sich erweisen, dass sich ihre Forderungen nicht nur auf die physische Verletzbarkeit bezogen. Verlangt wurde nicht allein der Schutz vor Angriffen aller Art, der das Leben auf dem Campus betraf, sondern eben auch vor dem, was von ihnen als intellektuelle Zumutung, als psychische Belastung erlebt wurde. Dazu zählten auch die bisweilen scharf geführten argumentativen Auseinandersetzungen, die es in strikter Absehung jeder einzelnen Person zu bestreiten galt. Beim Ringen um das beste Argument sollte, so hatte das Jürgen Habermas einst prominent vertreten, niemand ausgeschlossen, aber eben auch niemand geschont werden.
Genau diese Schonhaltung wurde nun aber immer vehementer eingefordert. Und die Hochschulleitungen der Spitzenuniversitäten unternahmen (fast) alles, um ihre hohe Studiengebühren entrichtende Kundschaft nicht zu verprellen. So entpflichtete etwa die Leitung der Harvard University 2018 den Juraprofessor Roland Sullivan von seiner Aufgabe als Faculty Dean des Winthrop House, als Studierende ihr „Unbehagen“ darüber artikulierten, dass dieser von Harvey Weinstein in das Team seiner Verteidiger berufen worden war. Die Studierenden der Harvard University fühlten sich von dieser Tatsache in ihrem „Sicherheitsgefühl“ so sehr eingeschränkt, dass sie auf dessen Ablösung drängten. Sie lehnten es ab, dass ein Mitglied des Verteidigungsteams von Weinstein, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht verurteilt worden war, noch länger mit der pädagogischen Leitung des Wohnheims betraut würde. Dass sich mehr als 50 Kolleg*innen der Juristischen Fakultät in einem Solidaritätsschreiben gegen die Suspendierung ihres Kollegen aussprachen und daran erinnerten, dass in einem Rechtsstaat jede*r Angeklagte*r den Anspruch auf einen Rechtsbeistand besitze – und das unabhängig davon, wessen er bezichtigt wird –, fiel nicht weiter ins Gewicht. Sullivan, der sich den Unmut der Studierenden zugezogen hatte, wurde von der Hochschulleitung seiner Aufgabe entbunden und von dieser nicht einmal angehört.2
Von wenigen sind die beträchtlichen Herausforderungen, vor denen Bildungseinrichtungen seither stehen, so klar und präzise benannt worden wie von der US-amerikanischen feministischen Historikerin Joan Wallach Scott. Auch ihr ist es ein Anliegen, dass auf dem Campus alle ihrem Studium unbehelligt nachgehen können; auch sie macht sich für einen weniger verletzenden Sprachgebrauch stark und selbstverständlich setzt sich auch Scott für die körperliche und psychische Unversehrtheit der Studierenden ein. Gleichzeitig beharrt sie aber darauf, dass die Wissenschaft ihrer eigenen Logik folgt, und dass sie diese zu schützen gehalten ist. Im Hörsaal wie auch im Seminarraum sind alle Aussagen begründungspflichtig; hier geht es nicht um den Austausch von Befindlichkeiten oder um die Praxis der „Free Speech“, wie manche irrtümlich annehmen, sondern um das Streben nach Erkenntnis. Colleges müssten sich daher um die Etablierung einer akademischen Streitkultur bemühen; sie seien, so Scott, in dieser Hinsicht von „Safe Spaces“ kategorial verschieden. Weder könne es im Interesse der Studierenden liegen, wenn die Praxis der „Trigger Warnings“ dazu führe, dass diese in erster Linie als fragile, hochgradig beschützenswürdige Subjekte adressiert würden, die es von den inhaltlichen Auseinandersetzungen zu bewahren gelte, noch könnten sie daran interessant sein, dass aus einer falschen Fürsorge heraus sämtliche Themen, die als belastend erlebt werden könnten, – also etwa „rape, violence, race“3 –, aus dem Curriculum gestrichen würden.
Weil der Safe Space in erster Linie als Schutzraum der weißen queeren Community interpretiert und zugleich als identitätspolitisches Instrument betrachtet wurde, beförderte er genau jene Essentialisierung, gegen die sich avancierte Theorieprojekte wie der Poststrukturalismus, die Gender Studies und die Postcolonial Studies gewandt hatten.
Heute lässt sich konstatieren, dass Scotts Intervention weitgehend ungehört verhallte. Insbesondere die Diskussion um die Lehrinhalte hat sich seither zugespitzt; so sehen sich mancherorts Kolleg*innen aus der Erziehungswissenschaft mit der Forderung konfrontiert, im Rahmen ihrer Vorlesungen auf die Darstellung von Platons Höhlengleichnis zu verzichten, weil dieser in einer von Sklaverei geprägten Gesellschaft gelebt habe. Parallel werden unter dem Stichwort „Microagressions“ immer neue Formen des Umgangs identifiziert, die nun als problematisch gelten – und die Studierende mehr und mehr auf die Rolle des Opfers verpflichten.4 Um hier keine Missverständnisse zu provozieren: Die Ausdifferenzierung des Gewaltbegriffs ist eine wichtige Errungenschaft. Kannte die klassische Gewaltsoziologie mit der körperlichen Verletzbarkeit nur eine Quelle von Gewalt, verfügen wir heute über ein sehr viel feineres Instrumentarium, um unterschiedliche Formen von Gewalt zu identifizieren. Es soll daher keineswegs bestritten werden, dass Lehrpläne auch Ausdruck epistemischer Gewalt sein können. Aber es ist eben auch damit zu rechnen, dass manche studentische Initiative wichtige akademische Errungenschaften beschädigt.
Ebendies kann auch bei der Forderung nach der Einrichtung von Safe Spaces geschehen. Janna Mareike Hilger zeigt dies in ihrer bald erscheinenden Dissertation.5 Geschult an der Machttheorie Michel Foucaults, untersucht sie die Sicherheitsvorkehrungen US-amerikanischer Universitäten und verknüpft diese mit den Safe Space-Programmen jener Hochschulen, die als besonders fortschrittlich gelten. Häufig werden diese Programme im Rahmen von Diversity-Trainings angeboten, also von solchen Maßnahmen, mittels derer rassistischer Diskriminierung begegnet und die Akzeptanz der LGBTQ+-Community erhöht werden soll. So begrüßenswert dieses Engagement ist, es führt bisweilen zu nicht intendierten Folgen. Das erläutert Hilger an einem Fall der University of Colorado Boulder. Auch hier gibt es eine Campus-Polizei, Überwachungskameras sowie ein Notfallmeldesystem. Dieses informiert Studierende via SMS oder Mail, wenn mit einer Gefahr zu rechnen ist. Werden diese Messages verschickt, verstärke sich nicht nur auf dem Campus das Bedrohungsgefühl; jede*r werde nun angehalten, andere daraufhin zu beobachten, ob von ihnen eine Gefahr ausgehen könnte.
Geschieht dies in einer von rassistischen Strukturen geprägten Gesellschaft, bleibt das nicht ohne Folgen. Hilger verweist dabei auf einen Betroffenen, der im Frühjahr 2016, nachdem eine Notfallwarnung abgesetzt wurde, um seine Sicherheit fürchtete. Was er fürchtete, war jedoch nicht der Angreifer, der zu diesem Zeitpunkt bereits unschädlich gemacht worden war, es waren die Reaktionen seiner Kommiliton*innen: „Ich wusste, dass ich jetzt von tausenden Campusangehörigen umgeben war, die in ihrer Bedrohungsreaktion angesprochen wurden, und zwar durch das Umlegen eines Schalters.“ Und er fährt fort: „Es ist klar, dass ein Campus voller hochaktivierter und angsterfüllter weißer Menschen keinen Safe Space für People of Color darstellt und dies auch nicht darstellen kann.“6
Es kam hier, so Hilger, zu einem Effekt, der sicherlich von niemanden angestrebt worden war: Weil der Safe Space in erster Linie als Schutzraum der weißen queeren Community interpretiert und zugleich als identitätspolitisches Instrument betrachtet wurde, beförderte er genau jene Essentialisierung, gegen die sich avancierte Theorieprojekte wie der Poststrukturalismus, die Gender Studies und die Postcolonial Studies gewandt hatten.7 Wird das Konzept des Safe Spaces also sehr eng ausgelegt und vornehmlich von weißen Studierenden beansprucht, die in vielerlei Hinsicht als privilegiert gelten müssen, kann dies leicht „altbekannte, rassifizierende Abgrenzungsdynamiken“ freisetzen, die Bürgerrechtsbewegungen zu überwinden doch einst angetreten waren.8
Solche Effekte haben jüngst auch Nadine Maser und Sighard Neckel aufgedeckt. Als sie sich dem Awareness-Konzept zuwandten, das seit einigen Jahren in Clubs und auf Festivals, aber nun auch bei wissenschaftlichen Kongressen vermehrt zum Einsatz kommt, stießen sie ebenfalls auf bislang kaum diskutierte „Paradoxien eines Emotionsprogramms“. Auch sie befürworten eine Kultur der Achtsamkeit und die gesteigerte Sensibilität für unterschiedliche Formen der Verletzbarkeit. Sie unterstützen zudem die Bemühungen um den Abbau von Gewalt. Aber die beiden Soziolog*innen weisen zu Recht darauf hin, dass es problematisch ist, wenn die Definitionshoheit über „Bedrohungssituationen“ bei einer kleinen Gruppe hochgradig privilegierter Personen liegt: „Situatives Wohlbefinden wird dann zu einer legitimen Reaktion auf die Anwesenheit bestimmter Personengruppen und die Einrichtung von Safer Spaces zur notwendigen Konsequenz.“9 Ressentimentgeladene Beobachtungen können dann die Folge sein, nun allerdings schwer entzifferbar, weil sie die Codes von Achtsamkeit und Wokeness bedienen.
Genau dies gilt es zu verhindern: Statt auf dem Campus eine „Hermeneutik des Verdachts“ (Ricoeur) zu forcieren und Gruppen von Studierenden gegeneinander auszuspielen, kommt es darauf an, aus den vornehmlich an US-amerikanischen Hochschulen geführten Debatten um Safe Spaces zu lernen und diese künftig sehr viel grundsätzlicher zu führen. Insbesondere sind sie als Hinweis darauf zu interpretieren, dass die vielerorts diskutierte Verletzbarkeit ein Politikum ist. Diese ist, daran hat Judith Butler erinnert10, nicht nur zwischen den Ländern des Globalen Nordens und denen des Globalen Südens wie auch zwischen den Geschlechtern höchst ungleich verteilt, sondern häufig auch unter Studierenden. Ratsam ist es daher, nicht länger auf abstrakte Weise von Verletzbarkeit zu sprechen und diese zum Merkmal der Conditio Humana zu adeln, sondern als einen eminent politischen Sachverhalt zu begreifen. Es gilt, die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse als Indikator für prekäre Lebenslagen zu begreifen, als wichtige Hinweise auf Gefährdungen, die ungleich verteilt sind. Dieser Sachverhalt ist zu berücksichtigen, wenn hierzulande über die Entwicklung einer inklusiven Schulkultur oder die Förderung einer vitalen akademischen Streitkultur diskutiert wird.
1 Siehe hierzu: David Kaldewey, Der Campus als „Safe Space“. Zum theoretischen Unterbau einer neuen Bewegung. In: Mittelweg 36, Heft 4-5, 2017, S. 132-153.
2 Vgl. Markus Rieger-Ladich, Sensible Kunden, verletzbare Subjekte. Was sich auf dem Campus tut. In: Pädagogische Korrespondenz 2019, Heft 60, S. 69-86.
3 Joan Wallach Scott, Knowledge, Power, and Academic Freedom. New York-Chichester: Columbia University Press 2019, S. 140.
4 Vgl. hierzu etwa: Eva Berendsen/Saba-Nur Cheema/Meron Mendel (Hrgs.), Trigger Warnung. Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Berlin: Verbrecher Verlag 2019.
5 Angekündigt unter dem Titel: Janna Mareike Hilger, Safe Space. Sorge und Kritik nach Michel Foucault und Eve Sedgwick. Frankfurt/Main-New York: Campus 2023.
6 Janna Mareike Hilger, Sicherheit für alle, Sicherheit für einige: Wie US-Hochschulen mit #Safe Space Ungleichheiten zementieren. In: Geschichte der Gegenwart, 7. Dezember 2022; abgerufen: 29.01.2023.
7 Vgl. Albrecht Koschorke, Identität, Vulnerabilität und Ressentiment. Positionskämpfe in den Mittelschichten. In: Leviathan 50, Heft 3, 2022, S. 469-486.
8 Janna Mareike Hilger, Sicherheit für alle, Sicherheit für einige: Wie US-Hochschulen mit #Safe Space Ungleichheiten zementieren. In: Geschichte der Gegenwart, 7. Dezember 2022; abgerufen: 29.01.2023.
9 Nadine Maser/Sighard Neckel, Awareness - Paradoxien eines Emotionsprogramms, in: Leviathan 51, Heft 2, 2023, (im Erscheinen).
10 Judith Butler, Gefährdetes Leben. Politische Essays. Berlin: Suhrkamp 2005.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die rauchzeichen-Kolumnen bieten Ihnen Denkanstöße in der digitalen Welt über die reale Welt, Stellungnahmen und Positionen, aber auch Abseitiges, zum Hinschauen Führendes, Botschaften, die zur Annäherung einladen. Sie hinterfragen eingefahrene Positionen in gegenwärtigen Debatten. Sie wagen Quer- und Seitenblicke und zeigen neue Verbindungen und Zusammenhänge auf. Überparteilich, nicht-akademisch, pointiert.
Um möglichst viele Leserinnen und Leser zu erreichen, werden alle Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Werbeeinnahmen wird zugunsten einer angenehmen Leseerfahrung verzichtet.
Die Autorinnen und Autoren schreiben unbezahlt, und die Herausgeber stecken viel ehrenamtliches Engagement sowie eigene finanzielle Mittel in die Plattform. Damit wir die laufenden Kosten für Webmaster und Softwarepflege decken können, sind wir auf die freiwillige Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Sie können unsere Arbeit unterstützen: mit einem Abo auf Steady (in unterschiedlicher Größe) oder mit einer direkten Zuwendung.
Sie helfen uns auch sehr, indem Sie unsere Kolumnen bei Twitter, Instagram und Facebook liken oder teilen.
Vielen Dank!